Rechtspopulismus am filmischen Beispiel Eine Deutsche Partei
Abschnittsübersicht
-
Anlässlich der Idee, den Film Eine deutsche Partei gemeinsam mit dem Regisseur Simon Brückner den Schulkinowochen Niedersachsen, IG Metall Wolfsburg und Stadtjugendring Wolfsburg zu schauen, ist diese Einheit entstanden.

-
Diese Modul orientiert sich an den anerkannten fachlichen Prinzipien politischer Bildung. Eine wichtige Referenz ist dabei der "Beutelsbacher Konsens", der in den 1970er Jahren formuliert wurde, und seither besonders für die formale politische Bildung auf drei zentrale didaktische Leitgedanken verweist:

I. Überwältigungsverbot.
Es ist nicht erlaubt, den Schüler - mit welchen Mitteln auch immer - im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der "Gewinnung eines selbständigen Urteils" zu hindern . Hier genau verläuft nämlich die Grenze zwischen Politischer Bildung und Indoktrination. Indoktrination aber ist unvereinbar mit der Rolle des Lehrers in einer demokratischen Gesellschaft und der - rundum akzeptierten - Zielvorstellung von der Mündigkeit des Schülers.
2. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen.
Diese Forderung ist mit der vorgenannten aufs engste verknüpft, denn wenn unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschritten. Zu fragen ist, ob der Lehrer nicht sogar eine Korrekturfunktion haben sollte, d. h. ob er nicht solche Standpunkte und Alternativen besonders herausarbeiten muss, die den Schülern (und anderen Teilnehmern politischer Bildungsveranstaltungen) von ihrer jeweiligen politischen und sozialen Herkunft her fremd sind.
Bei der Konstatierung dieses zweiten Grundprinzips wird deutlich, warum der persönliche Standpunkt des Lehrers, seine wissenschaftstheoretische Herkunft und seine politische Meinung verhältnismäßig uninteressant werden. Um ein bereits genanntes Beispiel erneut aufzugreifen: Sein Demokratieverständnis stellt kein Problem dar, denn auch dem entgegenstehende andere Ansichten kommen ja zum Zuge.
3. Der Schüler muss in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und seine eigene Interessenlage zu analysieren,
sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene politische Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen. Eine solche Zielsetzung schließt in sehr starkem Maße die Betonung operationaler Fähigkeiten ein, was eine logische Konsequenz aus den beiden vorgenannten Prinzipien ist. Der in diesem Zusammenhang gelegentlich - etwa gegen Herman Giesecke und Rolf Schmiederer - erhobene Vorwurf einer "Rückkehr zur Formalität", um die eigenen Inhalte nicht korrigieren zu müssen, trifft insofern nicht, als es hier nicht um die Suche nach einem Maximal-, sondern nach einem Minimalkonsens geht.
^ Quelle: Hans-Georg Wehling (1977): Konsens à la Beutelsbach? Nachlese zu einem Expertengespräch. In: Siegfried Schiele / Herbert Schneider (Hrsg.): Das Konsensproblem in der politischen Bildung. Stuttgart, S. 173 - 184, hier S. 179f.
-
SWR2 Wissen Wie politisch dürfen Lehrkräfte sein?
Darf eine Mathelehrerin Coronaregeln ablehnen, ein Sportlehrer die Antifa bewerben? Demokratiebildung gehört zu Schule. Aber politische Kontroversen müssen verfassungskonform sein.
Beutelsbacher Konsens: 3 Grundsätze zur Orientierung für Lehrkräfte
Wie Lehrerinnen und Lehrer politische Haltungen im Unterricht umsetzen können, ist bereits 1976 formuliert worden, im sogenannten "Beutelsbacher Konsens". Er enthält drei Grundsätze, die das Ergebnis einer Tagung der baden-württembergischen Landeszentrale für Politische Bildung waren.
Bis heute gelten diese Grundsätze als richtungsweisend für die pädagogische Arbeit, die komplette Fassung lässt sich bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg nachlesen.
- Überwältigungsverbot. – Das heißt, Schülerinnen und Schüler dürfen nicht mit politischen Meinungen überrumpelt werden.
- Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen.
- Die Schülerinnen und Schüler müssen in die Lage versetzt werden, politische Situationen und eigene Interessenlagen zu analysieren.
Doch wer überhaupt seine politische Meinung sagen darf und wer nicht – auch darüber wird an manchen Schulen heftig gestritten. Das zeigte sich im Herbst 2021 bei der Bundestagswahl. Viele Schulen nahmen sie zum Anlass, Politikerinnen und Politiker der im Bundestag vertretenen Parteien zur Diskussion zu bitten. Mancherorts sorgte das wiederum für Diskussionen und sogar Proteste, vor allem, wenn es um die Frage ging, ob auch Vertreter der AfD zur Diskussion an die Schulen eingeladen werden sollten.
-
-
-
Die AfD wurde 2013 im Protest gegen die Eurorettungspolitik gegründet. 2017 gelang ihr der Einzug in den Bundestag. Ihre offene Hinwendung zum Rechtsextremismus haben der AfD bisher nicht geschadet. (BpB, 2022)
Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz "CC BY-NC-ND 4.0 - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International" veröffentlicht. Autor/-in: Frank Decker für bpb.de
-
Der Verfassungsschutz sieht Anhaltspunkte dafür, dass die AfD verfassungsfeindlich ist. Das geht aus einem detaillierten und geheimen Gutachten hervor, das wir in voller Länge veröffentlichen. Das Dokument gehört in die Öffentlichkeit und nicht in einen Panzerschrank, aus vielen Gründen. (Netzpolitik.org, 2019)
-
Für alle drei Landtagswahlen des Jahres 2017 stimmt die frühere Erkenntnis nicht mehr, dass Rechtsaußenparteien vor allem von jüngeren Wählern gewählt werden. Armin Pfahl-Traughber analysiert, wer der AfD im Saarland, in Schleswig-Holstein und in NRW seine Stimme gab. (BpB, 2017)
-
Wie hält es die AfD mit der Demokratie? Öffentlich wie privat dürfte diese Frage weiterhin kontrovers diskutiert werden, auch wenn mit André Poggenburg jüngst ein bekannter Vertreter des rechtsnationalen "Flügels" die Partei verlassen hat. Tom Thieme analysiert das Verhältnis der AfD zum Rechtsextremismus. (BpB, 2019)
-
Woher kommt dieses anhaltende Umfrage-Hoch der Rechtsaußen, das der AfD erstmals auch einen Landratsposten im thüringischen Sonneberg einbrachte? Der Bielefelder Soziologe Wilhelm Heitmeyer hält "den Begriff Protestwähler für komplett verharmlosend“. Im Interview reflektiert er über unnütze Parteiverbote, Versäumnisse in der politischen Bildung und einen drohenden schleichenden Tod von Demokratien. (BpB, 2023)
-
Rechtsextremismus, was ist das? Kurz und leicht verständlich erklärt im Glossar des Dossiers Rechtsextremismus auf www.bpb.de. Getextet von Toralf Staud, Johannes Radke, Heike Kleffner und FLMH. Eingesprochen von Jungschauspielern/-innen. (BpB, 2014)
Dieser Text und Medieninhalt sind unter der Creative Commons Lizenz "CC BY-NC-ND 3.0 DE - Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland" veröffentlicht. Autor/-in: Bundeszentrale für politische Bildungbpb für bpb.de
Sie dürfen den Text unter Nennung der Lizenz CC BY-NC-ND 3.0 DE und des/der Autors/-in teilen.
Sie wollen einen Inhalt von bpb.de nutzen?
-
-
-
Was ist eigentlich Rechtspopulismus? Hier kurz und einfach erklärt. Ausführlicher und trotzdem übersichtlich beschrieben findet ihr den Begriff im Online-Dossier "Rechtsextremismus" der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb: http://www.bpb.de/glossar-rechtsextre... Getextet von Toralf Staud, Johannes Radke, Heike Kleffner und FLMH. Eingesprochen von Jungschauspielern/-innen.
-
Für eine ganze Reihe von fremdenfeindlichen Protestparteien hat sich der Begriff "rechtspopulistisch" durchgesetzt. In der Forschung jedoch war lange umstritten, ob rechtspopulistische Parteien über eine gemeinsame ideologische Basis verfügen. Was ist Rechtspopulismus? Wie entsteht er? Welche Bezüge zum Rechtsextremismus gibt es? Der Politikwissenschaftler Marcel Lewandowsky von der Universität der Bundeswehr Hamburg spricht über die Genese und den ideologischen Gehalt dieser politischen Strömung.
-
-
-
Eine deutsche Partei - der Podcast ist ein Begleitprojekt des gleichnamigen beobachtenden Dokumentarfilms über die deutsche Rechtspartei AfD. Im Zuge seiner mehrjährigen Recherchen im Inneren der Partei, stieß Simon Brückner (Regisseur) auf viele Fragen, die sich in der beobachtenden Form des Films höchstens indirekt stellen ließen. Nun widmet er sich diesen Fragen im Gespräch mit Wissenschaftlerinnen, Denkern und Journalistinnen, die sich in ihrer ganz eigenen, originellen, oft streitbaren Art mit dem Thema beschäftigen, dem Thema Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, neue Rechtsparteien.
-
Die Webseite zu Eine deutsche Partei, dort findet sich u.a. Pressestimmen, Infomaterial, auch der Mediathekenlink zu 3Sat sowie ein Link zum Podcast:
-
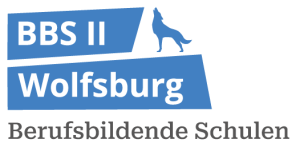

 Das Antwortet ChatGPT dazu:
Das Antwortet ChatGPT dazu:
 Um Deine Verortung im politischen Spektrum bestimmen zu können, kannst du hier Stellung zu insgesamt knapp 40 Positionen bzw. Fragen beziehen. Die Nutzung des Tests ist selbstverständlich anonym.
Um Deine Verortung im politischen Spektrum bestimmen zu können, kannst du hier Stellung zu insgesamt knapp 40 Positionen bzw. Fragen beziehen. Die Nutzung des Tests ist selbstverständlich anonym.